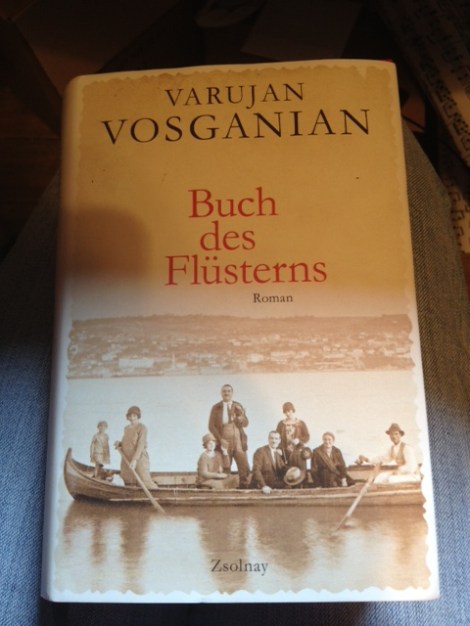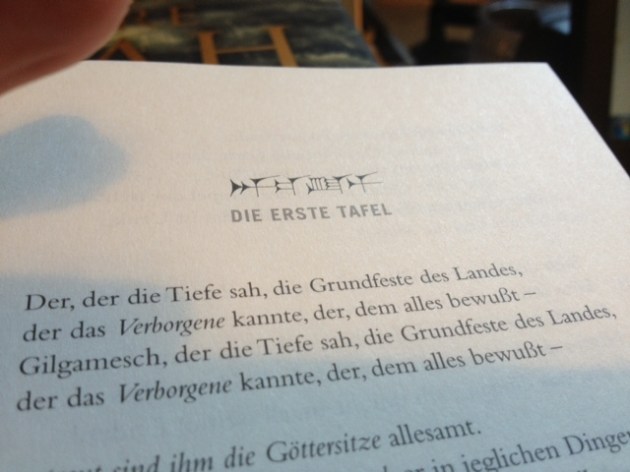Ein Geständnis:
Als ich sehr jung war – genauer gesagt knapp über dreißig – habe ich schon einmal einen Roman an einen Verlag verkauft. Das war alles sehr schön. Der Verlag passte zum Text, und die Leute, die mich betreuten, waren alle wohlwollend und gewillt, mich aufzubauen und mir Leine zu lassen, wie ich das hinterher nur noch ein einziges Mal (nämlich jetzt!) erlebt habe. Trotzdem fing ich in der Lektoratsphase ein unsägliches Gezerre um – aus heutiger Sicht – kaum relevante Punkte an, die sich bald verselbstständigten und nicht mehr auszuräumen waren. Am Ende blieb uns nur, den Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen, was mich mit einer seltsamen Erleichterung erfüllte. Der Freund und Kollege, der meine Schreibversuche von Anfang an begleitet und mir auf dem Weg zum Verlagsvertrag sehr geholfen hatte, war hingegen enttäuscht.
„Weißt du, was mit dir nicht stimmt?“, hat er mich gefragt. „Du hast Angst vorm Erfolg.“
Damals fand ich das hanebüchen. Heute glaube ich, zu wissen, was er meinte.
In den Jahren nach meiner ersten Veröffentlichung im Publikumsverlag habe ich Erfolg verzweifelt herbeigesehnt. Erfolg, das hätte bedeutet: endlich eine Möglichkeit, die unzähligen Stunden Schreiben einigermaßen finanzieren zu können, endlich mehr als viereinhalb Stunden schlafen, endlich einen Urlaubstag ohne Laptop verbringen, endlich ein Monat, von dem nichts mehr übrig ist, wenn das Konto leer ist. Vor allem hätte es bedeutet: Zufriedene Verleger, zufriedene Agentur. Und noch wichtiger – Menschen, die das Buch mögen. A job well done.
Ziemlich bald wurde aus dem Wunsch nach Erfolg die Angst vorm nächsten Misserfolg, wohl wissend, dass jeder davon mich näher ans Aus drückte. Und noch immer nicht wissend, wie man das macht: Leben ohne Schreiben. Aus dem Stoßgebet vor jeder Neuerscheinung – Möge es ein Erfolg werden – wurde: Möge es bitte nicht ganz so fulminant flopen. Daran, dass ich das Buch noch irgendwann schreiben könnte, das da draußen, wo es hinsollte, tatsächlich landet, habe ich nicht mehr geglaubt.
Und jetzt ist es da.
Ein paar Tage lang war das die ganz große Freiheit: Erfolg. Das haben wir jetzt gehabt. Das können wir abhaken und zum nächsten Thema übergehen. Dein erfolgreiches Buch hast du geschrieben, von jetzt an kannst du Schneid beweisen und schreiben, was du willst.
Aber so einfach funktioniert es nicht. Denn jetzt weiß ich, was das ist und worin sie sich begründet, die Angst vorm Erfolg.
Erfolg macht süchtig. Nicht der finanzielle Unterschied, denn ob der sich überhaupt auswirkt, weiß ich noch gar nicht. Aber das Gefühl, ein Buch geschrieben zu haben, das die, die es lesen, mögen. Etwas ausgeschickt zu haben, was angekommen ist. Was mit der Welt Kontakt aufnimmt und mein kleines Zeichen darin lässt, wenn auch nur für einen Augenblick.
Im ersten Rausch dachte ich: Jetzt schreib ich endlich eines nur für mich. Aber nur für mich geht nicht mehr. Das ist, als säße man allein an seinem Feuer und erzählte seine Geschichte den Nachtgeschöpfen, die auf Menschenstimmen gar nicht lauschen. Ich kann mit dem Gedanken nicht umgehen, danach wieder eines zu schreiben, das Kommentare erntet wie „hast dir ja wacker Mühe gegeben, aber …“, „das Buch ist sicher nicht schlecht, nur war’s mir zu anstrengend“ oder gar: „mir hat das keine Freude gemacht.“ Die ganz große Freiheit ist der ganz große Druck: Ich bin jetzt einer, auf dem Erwartung liegt, die er enttäuschen könnte. Nicht nur meine. Auch die von anderen. Das ist ziemlich atemberaubend. Es flößt meinen Fingern, die schreiben wollen, Furcht ein und verlangsamt ihren Lauf.
Und falls jetzt einer glaubt, ich habe diesen langen Salm geschrieben, um meinen Nabel gründlich zu besonnen, hat der vielleicht mehr recht, als mir lieb ist – aber nicht ganz. Mir ist das alles heute beim Laufen durch den Kopf gegangen, weil mir einfiel, dass ich (wie aufregend!) zum ersten Mal einen Roman schreibe, der von zwei Kunstschaffenden (das sind im weitesten Sinne schließlich auch wir Autoren von Unterhaltungsromanen) handelt. Von einem, der gewaltigen Erfolg hat, nach dem er nie gestrebt hat und für den er nicht gemacht ist, und von einer, die voller Ehrgeiz steckt und der jede Chance auf Erfolg zerschlagen wird. Vor allem aber fiel mir dabei ein, dass ich das überhaupt noch nicht thematisiert habe.
Vielleicht weil ich keine Erfahrung hatte – mit Erfolg?
Anyway. Ich gehe zurück ans Reißbrett. Und freu mich daran, dass mein Roman Ararat mir so nah ist. Auch wenn nicht mal der, den ich ganz allein mache, einer „nur für mich“ sein kann.