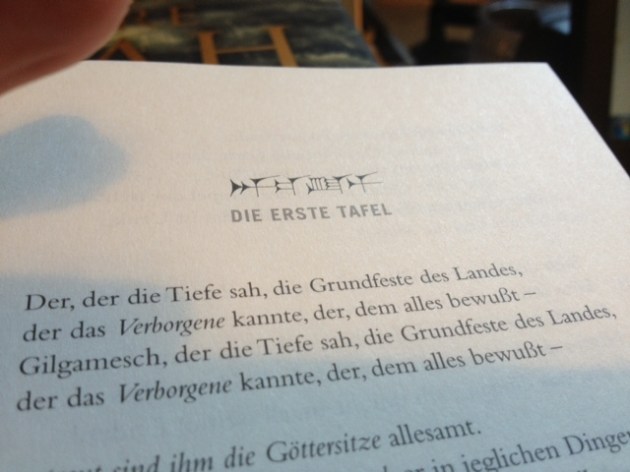War ich der, der nie Fortsetzungen schreiben wollte?
Der, der Fortsetzungen als Wurmfortsätze unrunder Geschichten bezeichnet hat, war nicht ich, oder etwa doch?
Meine Fortsetzung „Ararat“ ist kein Wurmfortsatz, sondern eine Wiedersehensparty. Eine Begrüßungsorgie am Bahngleis, das Zugticket, das man sich auf Pump kauft, weil die Sehnsucht es länger nicht aushält. Meine Fortsetzung „Ararat“ ist das kolossale Staunen: Nicht zu fassen, was aus euch geworden ist!
Nur den, der das lesen soll, wollen wir natürlich nicht draußen stehen lassen, während wir hier drinnen übereinander herfallen und uns in Entzückensrufen („Hach, bist du aber groß geworden“) ergehen. Weshalb es leider allmählich nötig wird, über die leidige Frage: Kratzt das einen?, nachzudenken.
Ich hab mein Liebespaar verlassen, als sie auf halb gepackten Koffern auf dem Sprung saßen, echauffiert, blitzäugig, tapfer ein bisschen Angst verbeißend und sich fest an den Händen haltend. Junge Leute halt – wir zwei gegen Himmel und Hölle und bis ans Ende der Welt. Beide hübsch, beide von der Art, auf deren Wangen alte Tanten Lippenstiftflecken hinterlassen. Meine Augensterne, my two and only.
Jetzt sind sie seit sechs Jahren angekommen, verheiratet, schon in dem Alter, in dem Ehemänner Hüftspeck ansetzen, aber sie kann nicht kochen, er hat Anorexie, und außerdem altern sie beide wie Wein. Sie haben sich ein Haus gebaut, und nun kommt die alte Tante (ich) zum ersten Mal zu Besuch. Die will natürlich vom Keller bis zum Boden geführt werden, in jeden Schrank spähen, unter jedes Bett linsen, sehen, in welchen Ständer er seine nach dem Lesen gefaltete Zeitung steckt und ihr zuschauen, wenn sie die nächste Rolle Klopapier aufhängt.
Die alte Tante arbeitet nicht mehr und wird demnächst samt ihrer Familie Konkurs anmelden müssen. Die alte Tante dreht Kopfkissen um und befühlt Tagesdecken, flötet: „Ich komm‘ mit euch zur Kirche, Kinder“ und drängt sich hinterher noch zum Einkaufen auf, prüft den Kaffeevorrat und will unbedingt die Nachbarn und den Hausarzt kennenlernen. Die alte Tante ist selig. Mit sich und der Welt im Reinen, zum ersten Mal, seit die hier hockt und schreibt.
Schreibt?
Nee, oder?
Womit sich die Lieblingsverwandten Nase und Hintern pudern, schreibt man doch nicht in einen Roman, den man anderen Leuten als höchst mitreißend verkaufen will. Ich fürchte, ich werde der alten Tante mal erklären müssen, dass das außer ihr selbst kein Schweinlein schert, ob ihr glutäugiger Liebling sich die Zähne mit Meersalz putzt und seine zauberhafte Gemahlin ihr Stullenpaket im Museum liegen lässt. Das ist jetzt nicht echt, oder? Trautes Heim, Glück allein, und das Honigkuchenpferd, das vor Stolz darauf platzt, bin – ICH?
Ich bin doch der mit den ganz düsteren, auf Sturm gebürsteten Geschichten voller angebrüteter Leute, die sich nie so verhalten wie der Hund von Onkel Rudis Schwiegermutter. Und jetzt will ich unbedingt aller Welt erzählen, wie zwei sich Opernkarten für Covent Garden bestellen – und die Oper fliegt dann nicht mal in die Luft? Was kommt als nächstes? Alte, ich fürchte, bevor die sich auch noch einen Dackel kaufen oder ihre Steuererklärung ausfüllen, während du tränenblind jauchzend daneben sitzt, müssen all diese hübschen marital-bliss-Szenen RAUS.
Darin war ich immer gut. Ein Klick und ab ins Nirwana.
ABER JETZT?
Ich kann doch nicht meine süße Gewitterhexe, die gegen einen Fleischwolf kämpft, in den Daten-Mülleimer schmeißen und die Kragennadelsammlung ihres Liebsten hinterdrein?
Das geht absolut nicht. Man klaut schließlich seiner alten Tante auch nicht ihr mit Blümchen beklebtes Fotoalbum! Ein bisschen zittrig nehm‘ ich den Finger vom Löschknopf und begreife nach über dreißig Jahren Leben als Kritzler, warum Kollegen eine Datei für Outtakes haben.
Die hab ich dann jetzt wohl auch. Und wie nenn‘ ich die? „Ararat Outtakes“? „Ein Sonntag bei Familie A. Januar 1938/Dezember 2014“? Oder „Wurmfortsatz III Material“?
NEIN.
Kommt nicht in Frage. Hatti und Ararat sind mein Geschenk an mich selbst für sämtliche verbleibenden Weihnachten meines Lebens. Die zwei sind das pure Glück, bringen uns empfindlich nah an den Rand des Ruins, und irgendwann ist Schluss. Dann muss man den Hals auch mal vollbekommen und wieder arbeiten, statt Verwandte zu besuchen.
Ich hab einen Mechanismus eingebaut, der garantiert, dass danach keine Hintertür mehr aufgeht, dass alle guten Dinge zwei bleiben, nicht drei werden (ich versprech euch beiden auch, ich werd euch nie „Dilogie“ nennen, sondern für alle Zeiten Hatti und Ararat). Ich druck mir dann halt meine Outtakes aus und kleb Blümchen zwischen die Seiten. So wie alle guten Tanten, die im Grunde ja wissen, dass hinreißende Liebespaare drei Kreuze machen, wenn die Alte wieder in den Zug steigt – und so schnell nicht wieder kommt.